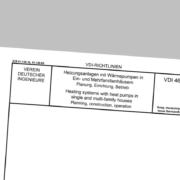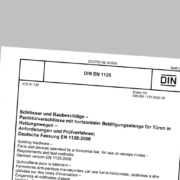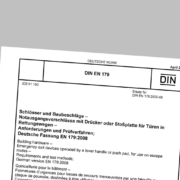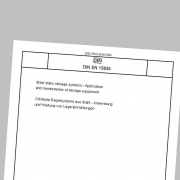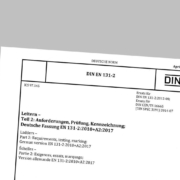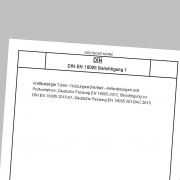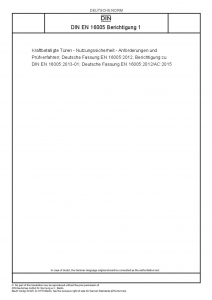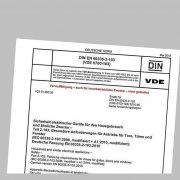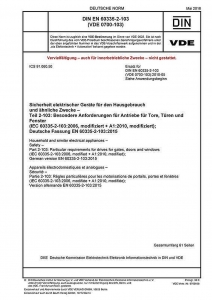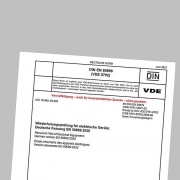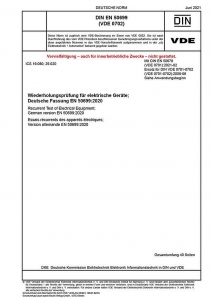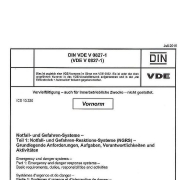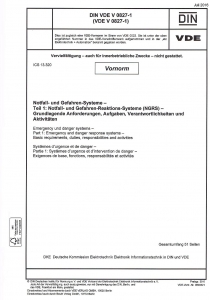Flächen für die Feuerwehr: Überarbeitete DIN 14090 erschienen
Zum 1. Februar 2024 ist für die Norm DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ eine überarbeitete Fassung erschienen. Damit wird die zuletzt gültige Fassung vom Mai 2003 ersetzt.
Der Norminhalt wurde fachlich vollständig überarbeitet, wobei das Hubrettungsfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12 nach DIN EN 14043:2014-04 „Hubrettungsfahrzeuge für die Feuerwehr – Drehleitern mit kombinierten Bewegungen (Automatik-Drehleitern) – Sicherheits- und Leistungsanforderungen sowie Prüfverfahren“ die Grundlage der Festlegungen ist. Zudem müssen zukünftig beispielsweise Zufahrten durch Hinweisschilder mit der Aufschrift „Feuerwehrzufahrt XX t“ und „Achslast max. XX t“ gekennzeichnet werden. Je nach Zufahrtssituation kann zudem ein Lageplanschild zur Orientierung erforderlich sein, damit die Gebäude eines Anwesens im Brandfall rasch erreicht werden können. In diesem Falle müssen auf dem Lageplan die Aufstellflächen und Feuerwehrzufahrten klar erkenntlich mit der Aufschrift „Flächen für die Feuerwehr“ dargestellt werden. Aufstell- und Bewegungsflächen müssen ebenso durch Hinweisschilder mit der Aufschrift „Fläche für die Feuerwehr XX t“ und „Achslast max. XX t“ gekennzeichnet werden.
Die DIN 14090:2024-02 – Entwurf legt Begriffe, Maße und Anforderungen für die im Baurecht geforderten Flächen auf dem Grundstück fest, die für die Rettung von Menschen und die Durchführung wirksamer Löscharbeiten notwendig sind. Die Norm enthält dafür die notwendigen Anforderungen an die Ausführung von Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken. Es ist inhaltlich auch auf Flächen für die Feuerwehr im öffentlichen Bereich übertragbar und ist in Verbindung mit den Normen für Hubrettungsfahrzeuge, insbesondere Hubarbeitsbühnen nach DIN EN 1777 beziehungsweise DIN 14701-1 sowie Drehleitern nach DIN EN 14043 und DIN EN 14044 anzuwenden. Insbesondere sind in diesen Dokumenten Anforderungen an die Ausführung und Beschaffenheit von Zugängen, Zufahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen und Darstellung der Flächen (zum Beispiel in Plänen) festgelegt.