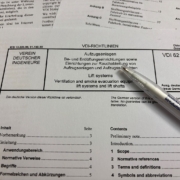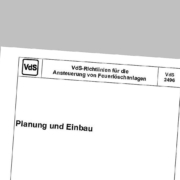VdS 2496
VdS-Richtlinien für die Ansteuerung von Feuerlöschanlagen, Planung und Einbau
Übersicht | Inhalt | Richtlinie bestellen | Weitere Informationen
Übersicht
Diese Richtlinien gelten für die Ansteuerung und Steuerung von ortsfesten, automatisch und nicht automatisch ausgelösten Feuerlöschanlagen. Der Anwendungsbereich umfasst Anlagen mit Steuereinrichtungen, die mit
– elektrischer
– mechanischer
– pneumatischer oder
– hydraulischer
Energie oder einer Kombination dieser Energien betrieben werden.
Diese Richtlinien gelten nicht für Anlaufsteuerungen von Pumpen- und Kompressoranlagen. Sie gelten nicht für Anlagen z. B. auf Schiffen, in Fahrzeugen und im Bergbau unter Tage. Für diese Anlagen können diese Richtlinien sinngemäß angewendet werden, soweit keine besonderen Regelungen hierfür gelten
Diese Richtlinien gelten nicht für Funkenlöschanlagen, Pulverlöschanlagen, Explosionsunterdrückungs- und Inertisierungsanlagen.
Für Ansteuerungen von neuen Löschtechniken nach VdS 2562 oder Schutzkonzepten nach VdS 3115 gelten die jeweiligen Vorgaben des Konzeptes bzw. Systems.

Inhalt
VdS 2496 Inhaltsangabe
1 Vorwort
1.1 Allgemein
1.2 Gültigkeit
2 Anwendungsbereich
3 Mitgeltende Regelwerke
4 Begriffe und Abkürzungen
4.1 Begriffe
4.2 Abkürzungen
5 Allgemeine Anforderungen
5.1 Gerätespezifische Voraussetzungen
5.1.1 Geräte- und Systemanerkennung
5.1.2 Standardschnittstelle Löschen
5.1.3 Anschluss und Wirkungsbereich
5.2 Ausführung
5.2.1 Allgemeines
5.2.2 Direkte Ansteuerung von Ventilstationen
5.2.3 Gesamtverantwortung
5.3 Allgemeine Anforderungen an die Steuerung und Ansteuerung
5.3.1 Allgemeines
5.3.2 Überspannungsschutz
5.3.3 Auswirkung von Fehlern
5.3.4 Anschluss und Wirkungsbereich der Steuereinrichtung
5.3.5 Funktionen einer Feuerlöschanlage, die an eine Brandmeldeanlage
delegiert werden dürfen
5.3.6 Weiterleitung von Meldungen
5.3.7 Rückstellbarkeit
Ansteuerung von Feuerlöschanlagen VdS 2496 : 2024-08 (07)
6 Besondere Anforderungen an die Steuerung und Ansteuerung bei verschiedenen Feuerlöschanlagen
6.1 Vorgesteuerte Trockenanlagen
6.1.1 Allgemeines
6.1.2 Vorgesteuerte Alarmventilstation Typ A1
(double action, single in-terlock with fail safe
6.1.3 Vorgesteuerte Alarmventilstation Typ A2 (single interlock)
6.1.4 Vorgesteuerte Alarmventilstation Typ B
(trocken-schnell, primed single interlock)
6.1.5 Vorgesteuerte Alarmventilstation Typ C (double interlock)
6.1.6 Anzeige des Betriebszustands
7 Anforderungen an die Branderkennung
7.1 Automatische Branderkennung
7.2 Handansteuereinrichtungen
7.2.1 Auswahl
7.2.2 Farbgebung und Beschriftung
7.3 Vermeidung von Falschauslösungen
7.4 Installation von automatischen Branderkennungselementen
und deren Auslösekonditionen
7.4.1 Gas-, Sprühwasser-, Schaum-, Aerosol-Löschanlagen und Wassernebel-Systeme
7.4.2 Vorgesteuerte Alarmventilstationen
7.5 Umfang der Überwachung
8 Standardschnittstelle Löschen
8.1 Ausführung, Planung und Einbau
8.1.1 Umfang
8.1.2 Anzeigen
8.1.3 Schnittstellenanschlüsse
8.1.4 Verteilergehäuse
8.1.5 Gemeinsame Absprache
8.2 Bezeichnungen
8.2.1 Anschlusspunkte
8.2.2 Übertragung von Meldungen, Störungen und zusätzlichen Informationen
9 Leitungsnetz
9.1 Überspannungsschutzmaßnahmen
9.2 Funktionserhalt
10 Inbetriebsetzung, Überprüfung und Abnahme durch den Betreiber
11 Instandhaltung
11.1 Zuständigkeit
11.2 Durchführung der Instandsetzungsarbeiten
11.3 Änderungen und Erweiterungen
11.4 Wesentliche Änderungen
12 Abschaltung und Blockierung
Anhang A (informativ) Beispiele einer elektrisch über BMA ausgelösten Gas-Feuerlöschanlage
Anhang B (informativ) Beispiel einer pneumatisch ausgelösten Gas-Feuerlöschanlage
Anhang C (verbindlich) VdS-Standardschnittstelle Löschen, erweiterter Anschlussplan
Anhang D (informativ) Prüfbescheinigung der gemeinsamen Inbetriebsetzung
Anhang E (informativ) Abnahmebescheinigung
Anhang F (verbindlich) Direkte Ansteuerung
Technische Daten und Anschaltbedingungen
Anforderungen und Verantwortlichkeiten
Hinweise zur Tabelle F-1
Hinweise zur Berechnung des zulässigen Leitungswiderstands
Anwendungs- und Berechnungsbeispiele
Anhang G (informativ) Verantwortlichkeiten
Anhang H (informativ) Vernetzte Brandmeldeanlagen mit Löschanlagen
Richtlinie bestellen
Stichworte
Feuerlöschanlagen, Brandschutz, Grundlagen, Brandursachen, Schutzziele, Brandschutzmaßnahmen, abwehrend, vorbeugend, organisatorisch, technisch, baulich, bautechnisch, Feuerschutzwesen, Brandklassen, Baustoffklassen, Feuerwiderstandsklassen, Normen, Richtlinien