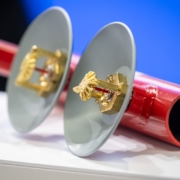Reifegradmodell für Rechenzentren
In der Normenreihe DIN EN 50600 ist im Dezember 2023 die deutsche Übersetzung der zweiten Ausgabe des Normenteils DIN CLC/TS 50600-5-1 VDE V 0801-600-5-1 „Informationstechnik – Einrichtungen und Infrastrukturen von Rechenzentren. Teil 5-1: Reifegradmodell für Energiemanagement und Umweltverträglichkeit“ erschienen. Dieses Dokument definiert ein Reifegradmodell für die Umweltauswirkungen der in einem Rechenzentrum untergebrachten Einrichtungen, Infrastrukturen und Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und führt zu diesem Zweck fünf aufeinander aufbauende Reifegrade ein, inklusive Best Practices, die von Experten aus ganz Europa vorgeschlagen und abgestimmt wurden.
In der Anwendung ermöglicht die neue Technische Spezifikation Betreibern von Rechenzentren einerseits einen Weg zur kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Andererseits unterstützt es Planer darin, für neue Rechenzentren den Bauherren gute Empfehlungen für ein energieeffizientes und nachhaltiges Design zu geben.
Autor: Dr. Ludger Ackermann, Senior Data Center Consultant, Data Center Excellence GmbH
Weitere Informationen
- Normenreihe DIN EN 50600, Beuth Verlag
- DIN CLC/TS 50600-5-1 VDE V 0801-600-5-1:2023-12 „Informationstechnik – Einrichtungen und Infrastrukturen von Rechenzentren. Teil 5-1: Reifegradmodell für Energiemanagement und Umweltverträglichkeit“, VDE Verlag
- Planerbrief 46 – März-April 2024
- Planerbrief – Übersicht