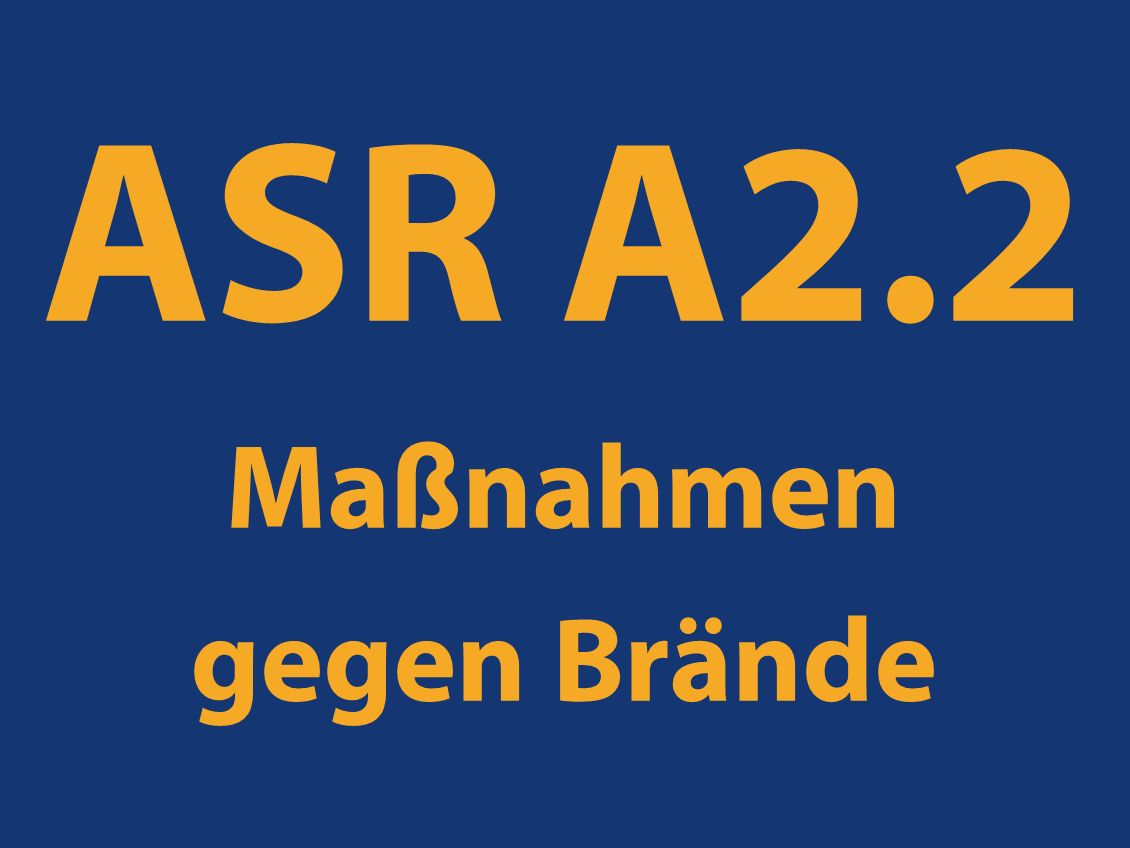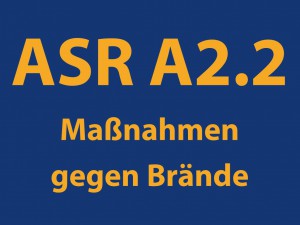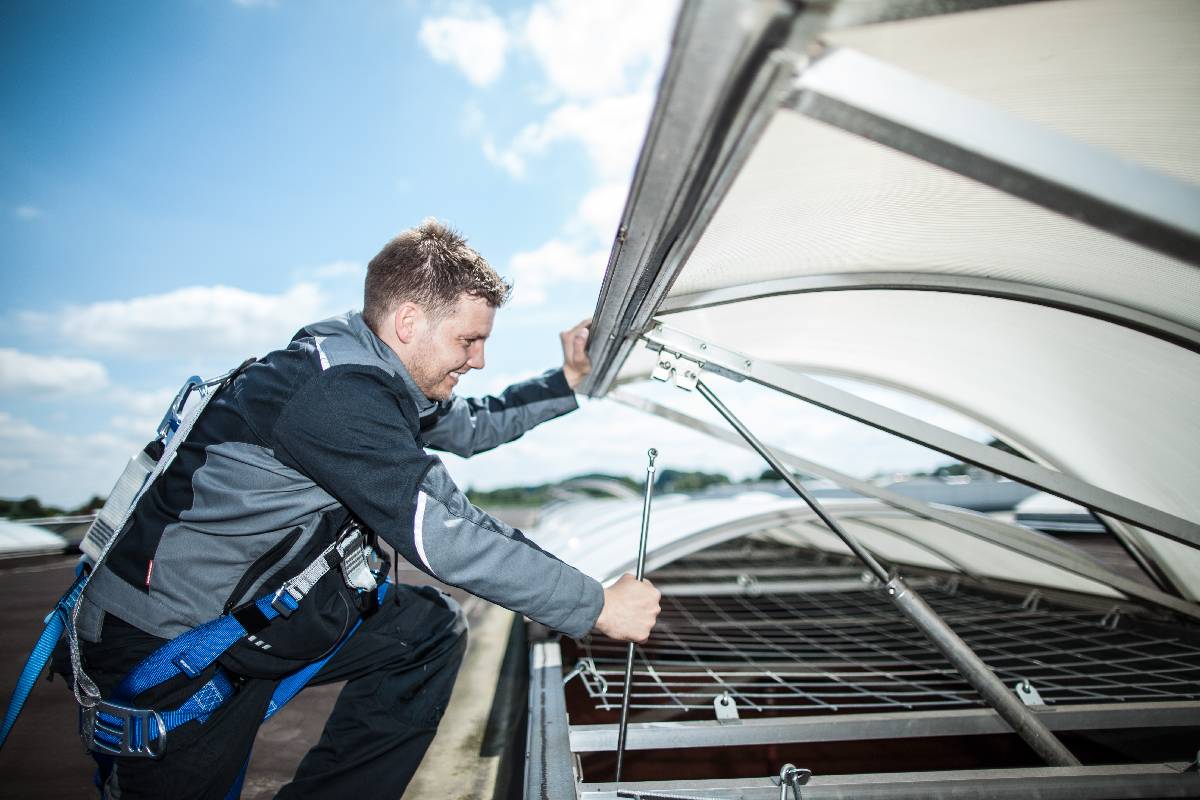Gesundheit im Betrieb
 Auf gute Gesundheit!
Auf gute Gesundheit!
Gesundheit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Beschäftigte und Unternehmen ihrer Tätigkeit erfolgreich nachgehen können. Um das körperliche und psychische Wohlbefinden zu gewährleisten, ist es wichtig, Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten und Gesundheitskompetenzen der Beschäftigten zu stärken.
Genau wie die Planung, Errichtung und der Betrieb eines Gebäudes, erfordert die nachhaltige Verankerung des Themas „Gesundheit“ im Betrieb ein systematisches Vorgehen. Zur Unterstützung bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements hat die gesetzliche Unfallversicherung VBG das Angebot „GMS – Gesundheit mit System“ mit einem 7-stufigen Handlungskreislauf entwickelt: 1. Günstige Rahmenbedingungen schaffen, 2. Bestandsaufnahme, 3. Auswertung, 4. Ziele, 5. Maßnahmen, 6. Umsetzung, 7. Erfolgskontrolle und Verbesserung. Durch stetiges Durchlaufen des GMS-Handlungskreislaufs wird das Thema Gesundheit nachhaltig im betrieblichen Kontext verankert und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess gewährleistet.
Ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist nicht nur für Großbetriebe sinnvoll. Im Gegenteil: Gerade wer weniger Beschäftigte hat, muss sich nachhaltig und systematisch um deren Gesundheit kümmern, um langfristig am Markt bestehen zu können.
Autor: Tobias Belz (tb), Koordinator des Präventionsfelds Gesundheit mit System (GMS), Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
Weitere Informationen