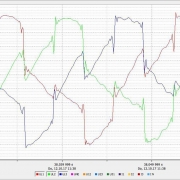In 2019 hatte Bioenergie – bezogen auf die Sektoren Wärme, Strom und Mobilität – einen Anteil von über 50 Prozent an erneuerbaren Energien. Biomasse wird auf Grund seiner Vielseitigkeit im künftigen Energiesystem verschiedene Funktionen übernehmen. Doch was heißt dies konkret für die Energiewirtschaft?
Biogas kann die fluktuierenden Erzeuger Wind und Sonne flexibel ausgleichen und stellt zusätzlich mit der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) die Grundlast in Wärmenetzen. Holz wiederum stellt den größten Anteil an erneuerbarer Wärme, ist aber auch für die Industrie als Träger von Prozessenergie wichtig.
Zudem hat sich seit 2021 einiges geändert. So läuft etwa bei alten Bioenergieanlagen sukzessive die Refinanzierung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus. Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die nachhaltige Bereitstellung von Biomasse, die nur noch im Reststoffbereich, nicht aber im Waldholzbereich oder im Biogasbereich ausgebaut werden kann.
So hat zum Beispiel die Klimaschutzstadt Kiel für die Kielregion ein Projekt aufgesetzt, um im Diskurs mit NGOs, Unternehmen und Biomasseanbietern zu erarbeiten, wieviel Biomasse aus der Region in Modellprojekten eingesetzt werden kann. Zum anderen betrachtet das Projekt „Transbio“ die Möglichkeiten von Bioenergieanlagen außerhalb der Refinanzierung des EEG. Diese Initiativen gilt es zu beobachten. Ergebnisse sollten in aktuelle Planungen einfließen.
Autor: Bernhard Wern, Arbeitsfeldleiter Stoffströme, Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme (IZES gGmbH) an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW)
Weitere Informationen