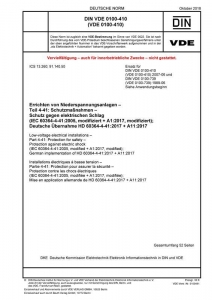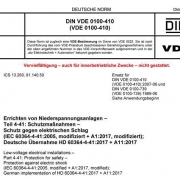BGV Expertentag Elektrotechnik 2023
BGV Expertentag Elektrotechnik 2023
Einladung | Termin | Teilnahmegebühr | Beschreibung | Programmablauf | Referenten | Aussteller | Anmeldung | Ansprechpartner | Weitere Informationen
Einladung
![]() Einladung – BGV Expertentag Elektrotechnik 2023 (PDF)
Einladung – BGV Expertentag Elektrotechnik 2023 (PDF)
![]() Teilnahmebedingungen – BGV-Expertentag Elektrotechnik 2023 (PDF)
Teilnahmebedingungen – BGV-Expertentag Elektrotechnik 2023 (PDF)
![]() Anmeldung – BGV-Expertentag Elektrotechnik 2023 (PDF)
Anmeldung – BGV-Expertentag Elektrotechnik 2023 (PDF)
![]() Hinweise zum Datenschutz bei Veranstaltungen der BGV (PDF)
Hinweise zum Datenschutz bei Veranstaltungen der BGV (PDF)
Termin
16.-18. Oktober 2023
BGV Immobilien GmbH & Co. KG | Durlacher Allee 56 | 76131 Karlsruhe
Teilnahmegebühr
Der Teilnahmegebühr pro Teilnehmer beträgt 299 Euro brutto.
Beschreibung
Die Elektrotechnik verändert sich ständig, neue Vorschriften, Normen und auch die Vorgaben der gesetzlichen Unfallversicherungen sowie VdS und nicht zuletzt auch die Versicherer ändern ihre Regelwerke und bekommen nicht alles mit, bzw. werden über alles informiert.
Mit dieser Veranstaltung will die BGV Immobilien GmbH & Co. KG (Badische Verischerungen) eine unabhängige Plattform anbieten, um Wissen, Informationen und Neuigkeiten, neutral und ungezwungen im Kollegenkreis zu vermitteln.
Natürlich werden auch Firmen einige Beiträge beisteuern, jedoch steht der Transfer und Austausch in erster Linie.
In diesem Jahr wieder einige Höhepunkte, wie zum Beispiel:
- Praktische Themen in Mannheim, bei der Sparkasse RNN gelebte EMV beim Umbau
- Praktischer Versuch am Mittwoch von Herrn Otto, evtl. einer seiner letzten Auftritte vor dem (un-) Ruhestand
- Fachbuchautoren sind mit vor Ort, Herr Dürr, Herr Otto und Herr Fengel – Die Autoren stehen Rede und Antwort und haben Ihre Bücher vor Ort dabei
- Interessante Vorträge und Hersteller mit Objekten und auch mal was zum anfassen
- EMV und Energieeffizienz als Hauptthema
- LED-Umbau, was muss, was kann und auch Musterräume und Bürobeleuchtung vor Ort beim BGV umgebaut
- Neues Poster von Herrn Otto und SV Wolfinger aufgelegt, werden kostenlos an die Teilnehmer verteilt

Programmablauf
Folgender Programmablauf ist geplant:
Montag, 16. Oktober 2023
bis 12:00 Uhr Anreise
Sparkasse Rhein Neckar Nord in Mannheim, D1 1 – 3, 68159 Mannheim
Führung nach Modernisierung durch NSHV SV / AV Trafo und Unterverteiler
verschiedene Gruppen zu max. 15 Teilnehmer
Herr Becker, Sparkasse Rhein Neckar Nord, Mannheim
Anreise mit ÖPNV oder per Auto möglich, Tiefgarage vorhanden,
bitte Fahrgemeinschaften bilden
ab 16:00 Uhr Rückreise zum BGV nach Karlsruhe
ab 18:00 Uhr Abendveranstaltung mit Vorstellung der Hausmesse / Hersteller im BGV Lichthof in Karlsruhe
gegen 21.00 Uhr Ende Abendveranstaltung
Dienstag, 17. Oktober 2023
08:30 Uhr Kaffeeempfang
08:45 Uhr Begrüßung und Eröffnung des Expertentreffs 2023
Herr Matthias Kreibich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, BGV-Versicherung AG
09:00 Uhr Begrüßung und Einweisung
Herr Dierk Wolfinger, BGV-Versicherung AG
09:30 bis 10:30 Uhr 1. Vortrag
Rückblick Sparkasse RNN von Vortag, Neubau BGV-Parkgebäude,
Herausforderung, Umsetzung EMV im Verwaltungsgebäude,
Neues aus der Normenwelt
Herr Dierk Wolfinger, BGV-Versicherung AG, Karlsruhe
10:30 bis 10:45 Uhr Kaffeepause
10:45 bis 11:45 Uhr 2. Vortrag
Praxisversuch Einleiter-, Mehrleiterkabel und ein Fall aus der Gutachtertätigkeit,
Herr Dipl.-Ing. Werner Henke, Radolfzell
11:45 bis 12:45 Uhr 3. Vortrag
Allgemeine Betreiberpflichten – Relevanz und Risiko sowie Grundlagen der Prüfpflicht,
Herr Oliver Vollmar, BGV-Versicherung AG, Karlsruhe
12:45 bis 13:45 Uhr gemeinsames Essen im BGV-Restaurant
13:45 bis 15:00 Uhr 4. Vortrag
Leuchtmittelverbot – was sind die Alternativen?
Wie beurteile und messe ich die Qualität des LED Lichts?
Herr Link, Ledvance
Förderung vom Staat – BEG Förderung, Neue Norm 12464.
Herr Huck, Sonepar NdL Karlsruhe
15:00 bis 15:30 Uhr Kaffeepause
15:30 bis 17:00 Uhr 5. Vortrag
EN 50522 (nur Verteilungstrafo HS-NS-Seite) und DIN 18014,
Herr Prof. Dr.-Ing. Ismail Kasikci, Hochschule Biberach
17:00 Uhr Ende 2. Seminartag
18:00 Uhr gemeinsames Abendessen in der Nähe des BGV
– nicht in den Seminarkosten beinhaltet –
Mittwoch, 18. Oktober 2023
08:30 bis 09:00 Uhr Kaffeeempfang
09:00 bis 10:30 Uhr 6. Vortrag
Tücken und Deckungslücken bei Versicherungen für Sachverständige und Betreiber
Herr Lachstädter, Dresdener Finanzhaus Maklergesellschaft mbH, Keltern
10:30 bis 10:45 Uhr Kaffeepause
10:45 bis 11:45 Uhr 7. Vortrag
Technikerarbeit Energiemanagment am Beispiel BGV
11:45 bis 12:45 Uhr 8. Vortrag
Technikerarbeit Energiemanagment am Beispiel BGV
Herr Gültekin, Heinrich-Herz-Schule Karlsruhe
12:45 bis 13:45 Uhr gemeinsames Essen im BGV-Restaurant
13:45 bis 14:30 Uhr 9. Vortrag
45 Jahre Berufserfahrung als ö. b. u. v. Sachverständiger,
Erfahrungen ist durch nichts zu ersetzen
Herr Dipl.-Ing. Karl-Heinz Otto, Düsseldorf
14:30 bis 15:15 Uhr 10. Vortrag
4aktuelles Thema bzw. Abschlussdiskussion
15:15 Uhr Kaffeepause
Referenten
Für die fachliche Unterstützung des Expertentages konnten folgende Referenten gewonnen werden:
- Dierk Wolfinger, BGV-Versicherung AG, Karlsruhe
- Werner Henke, EMV Messtechnik, Radolfzell
- Oliver Vollmar, BGV-Versicherung AG, Karlsruhe
- Bernd Link, Ledvance GmbH, Garching
- Bernd Huck, Sonepar Deutschland Region Süd GmbH, Karlsruhe
- Prof. Dr. Ismail Kasikci, Hochschule Biberach
- Michael Lachstädter, Dresdener Finanzhaus Maklergesellschaft mbH, Kesselsdorf
- Dicle Can Gültekin, Heinrich-Hertz-Schule Karlsruhe
- Karlheinz Otto, ö.b.u.v. Sachverständiger, Düsseldorf
Aussteller
Folgende Hersteller werden über die komplette Veranstaltung als Gesprächspartner zur Verfügung stehen:
- PH Plus, Messtechnik
- Janitza, Messtechnik
- Carl Elektroanlagen, Elektrounternehmen
- Bayka, Kabelhersteller
- Bachmann, Hersteller
- CFW EMV-Consulting AG, Erfinder und Patentinhaber
- WAGO, Hersteller
Anmeldung
Anmeldeschluss: 10. September 2023
Für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung und Anmeldebestätigung erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt per PDF-Anmeldeformular an Telefax 0721 660191605 oder E-Mail expertentreff@bgv.de.
Ansprechpartner

Herr Dierk Wolfinger
BGV / Badische Versicherungen, Abteilung Facility-Management
Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft – GvEFK – ANLB –
Durlacher Allee 56
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 660‐1605
Telefax: 0721 660‐191605
E-Mail: expertentreff@bgv.de

Weitere Informationen
- Einladung zum BGV Expertentag Elektrotechnik 2023 (PDF)
- BGV Versicherung AG (Badische Versicherungen)
Stichworte
BGV, Versicherung, Badische Versicherungen, Karlsruhe, Expertentag, Expertentreff, Elektrotechnik, Elektro, 2023