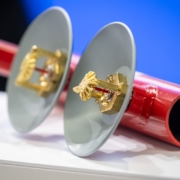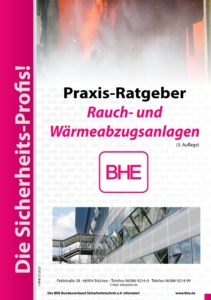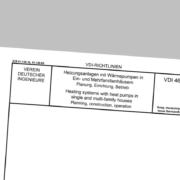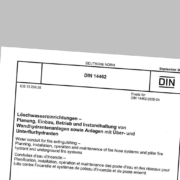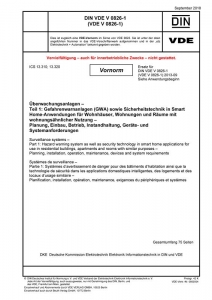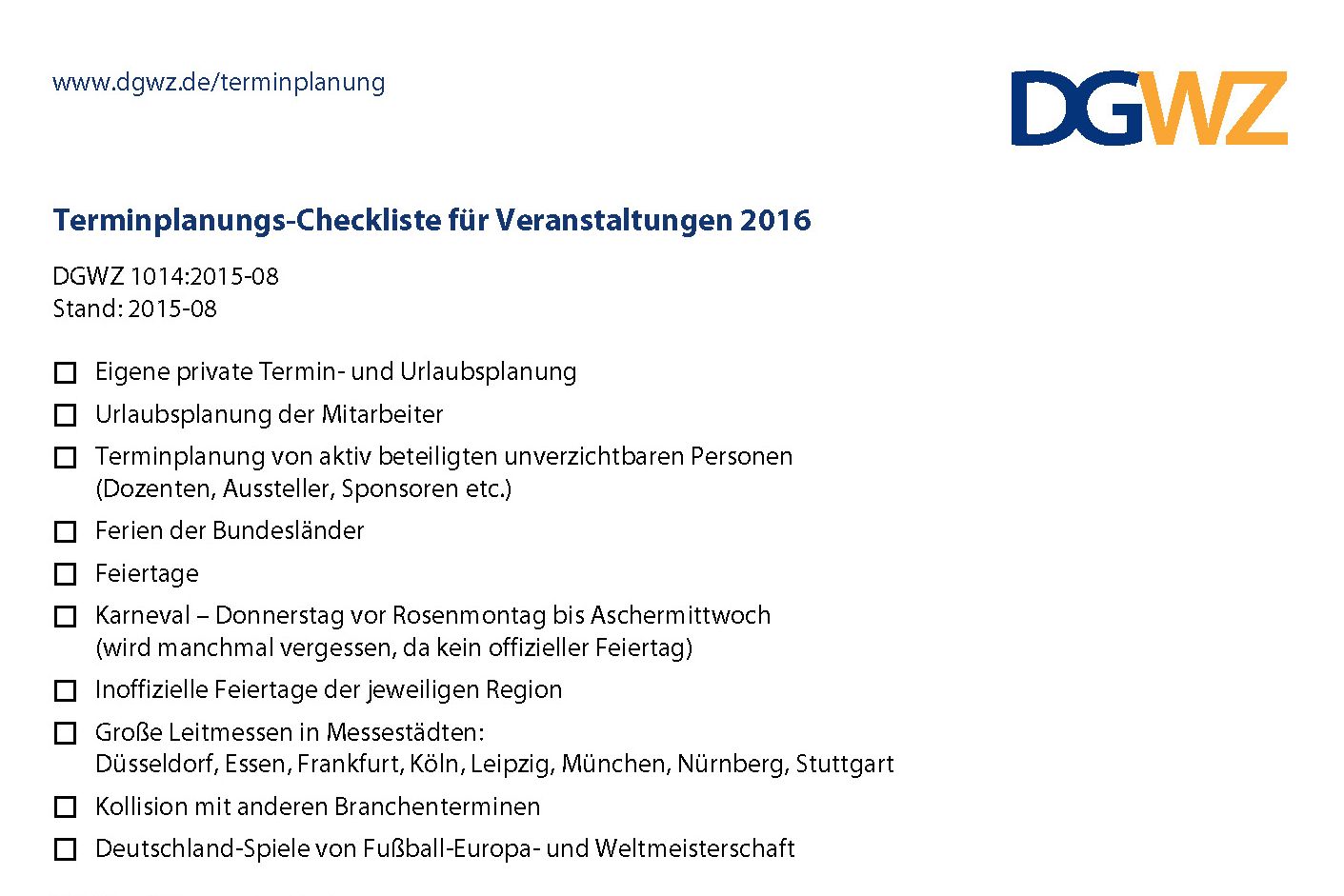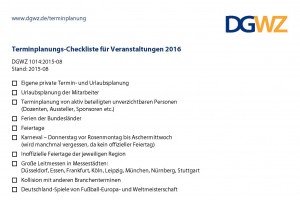VdS-Richtlinien für Wasserlöschanlagen
Die VdS-Richtlinien rund um Wasserlöschanlagen wurden überarbeitet und sind im Januar in einer neuen, aktualisierten Auflage erschienen. Zu den aktualisierten Regelwerken zählen:
- VdS CEA 4001:2024-01 – Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau
- VdS 2108:2024-01 – Richtlinien für Schaumlöschanlagen, Planung und Einbau sowie
- VdS 2109:2024-01 – Richtlinien für Sprühwasser-Löschanlagen, Planung und Einbau.
Die VdS-Richtlinien werden in regelmäßigen Abständen überarbeitet, so daß Anwendererfahrungen oder aktuelle Herstellerinnovationen berücksichtigt werden. Sie richten sich an Planer, Errichter und Betreiber von Wasserlöschanlagen sowie an Sachversicherer. Betreiber erhalten damit Hinweise, um Wartung und Instandhaltung nach dem aktuellen Stand der Technik durchzuführen.
Welche Änderungen wurden vorgenommen? In der VdS CEA-Richtlinie 4001:2024-01 zu Planung und Einbau von Sprinkleranlagen wurden neben redaktionellen Anpassungen die Angaben zur Wasserversorgung komplett überarbeitet. Vor dem Hintergrund immer größerer moderner Lager und Logistikzentren wurden Schutzkonzepte für mehrfachtiefe Regale, sogenannte Multiple-Row-Racks (MRR), neu aufgenommen. Zur Harmonisierung mit europäischen Regelwerken wurde die Klasseneinteilung (Klasse 1 und 2) aufgehoben. Die Vorgaben für Rohrleitungen wurden vereinfacht und an die prEN 12845-1 angepasst. Zum einfachen Nachvollziehen der in der neuen Richtlinie VdS CEA 4001 vorgenommenen Änderungen wird eine Synopse angeboten, in der detailliert alle inhaltlichen Änderungen hervorgehoben sind. Die relevanten Änderungen aus der VdS CEA 4001, unter anderem die zur Wasserversorgung, sind für die Richtlinien VdS 2108 und VdS 2109 übernommen worden.
Die überarbeiteten Richtlinien VdS CEA 4001, VdS 2108 und VdS 2109 sowie die Synopse zur VdS CEA 4001 sind im VdS-Shop erhältlich.
Weitere Informationen
- VdS CEA 4001:2024-01 – Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau
- VdS 2108:2024-01 – Richtlinien für Schaumlöschanlagen, Planung und Einbau
- VdS 2109:2024-01 – Richtlinien für Sprühwasser-Löschanlagen, Planung und Einbau
- Seminar Sprinkleranlagen
- Übersicht zu Sprinkleranlagen
- Planerbrief 46 – März-April 2024
- Planerbrief – Übersicht