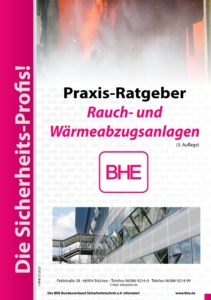Neues Seminarprogramm 2024
Für 2024 umfasst das Seminarprogramm der Deutschen Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit mehr als 380 Online- und Präsenzseminare rund um Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA), Betriebssicherheit, Arbeitsschutz und Brandschutz. Mit 27 praxisnahen Seminarthemen bietet die DGWZ bundesweit ein breites Spektrum an produkt- und herstellerneutralen Seminaren für Fachplaner, Architekten, Ingenieure, Errichter, Betreiber, Technische Leiter sowie Verantwortliche Personen und Fachkräfte von haustechnischen Abteilungen.
Alle Seminare werden von hochqualifizierten Referenten aus der Branche mit Praxisbezug und Schulungserfahrung geleitet. Die Veranstaltungen finden sowohl in Präsenz als auch online statt. Die fachlichen Inhalte und das vermittelte Wissen sind in beiden Formaten identisch. Auch die schriftliche Prüfung, die Qualifikation und der erreichte Abschluss sind gleich.
Autorin: Dr. Barbara Löchte, Marketing Kommunikation, Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit